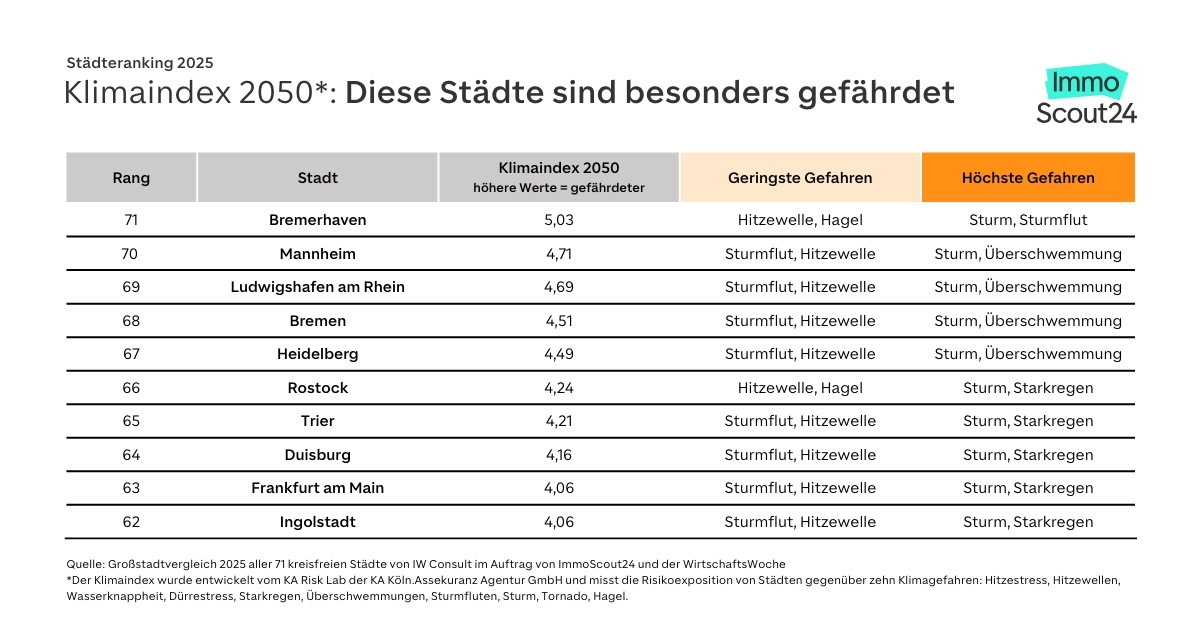Wohnungsmarkt zwischen Regulierung und Realität
Deutsche Wirtschaft: Verlangsamtes Wachstum in 2025, aber positive Tendenzen für 2026 / Wohnungsmarkt: Angebot bleibt hinter der Nachfrage zurück – strukturelle Ursachen überwiegen / Zuwanderung und Demografie prägen langfristig das Marktgleichgewicht / Regulierung und Baulandknappheit als zentrale Bremsfaktoren des Wohnungsbaus